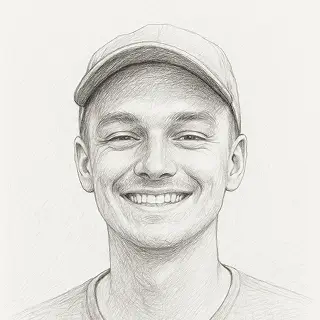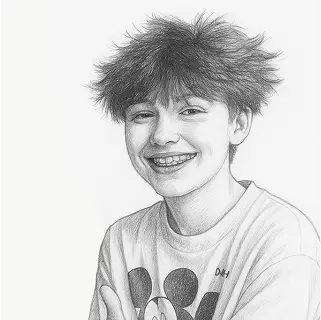„Klinische Studien – eine Chance für Patienten“
Klinische Studien ermöglichen den medizinischen Fortschritt – und sie eröffnen Menschen mir schweren Krankheiten die Möglichkeit einer innovativen Therapie. Vier Expertinnen und Experten berichten über die Chancen der klinischen Forschung.