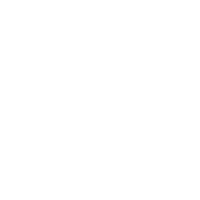Saarland
Medizin
Willkommen im Saarland
Willkommen im Saarland – dem sich wandelnden Industrieland im Herzen Europas voller Innovationskraft und Lebenslust. Im Land der kurzen Wege und starken Netzwerke arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam an Lösungen für die Zukunft. Tauchen Sie ein in eine facettenreiche Welt, in der Megatrends wie Nachhaltigkeit, Gesundheit und Digitalisierung mit Leben gefüllt werden.







Gut vernetzt zum Wohle der Patienten
Das neue Center for Digital Neurotechnologies Saar und das INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien werfen einen Blick in die nahe Zukunft und zeigen, warum sowohl Neurotechnologie als auch Materialwissenschaft im Saarland bereits Leuchtturmprojekte sind.
Computeroptimierte Operationsmethoden, verbesserte Behandlungsmethoden in der Geburtsmedizin oder die frühzeitige Erkennung von Krankheiten durch die Erhebung von Gesundheitsdaten: Im Zeitalter der Digitalisierung verschmelzen Medizin und Technik immer stärker. Deshalb erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Saar-Uni, der htw saar sowie des Zentrums für Mechatronik und Automatisierungstechnik (ZeMA) im Center for Digital Neurotechnologies Saar (CDNS), wie die engere Verzahnung von Mensch und Computer insbesondere auf dem Feld der Medizin in Zukunft kontinuierlich verbessert werden kann. Das interdisziplinäre Zentrum CDNS wurde Anfang 2022 auf dem Campus Homburg der Universität des Saarlandes eingerichtet und vernetzt dort mit der Universitätsmedizin, der Informatikforschung und der Saarwirtschaft einen großen Talentpool, eine hochwertige Hochschullandschaft und Partner sowie Tech-Netzwerke.
Übertragung menschlicher Nähe und Berührungen durch das Internet
Verschiedene Projekte des Techhubs werfen einen Blick in die nahe Zukunft, die längst mehr ist als Science-Fiction. So geht es zum Beispiel bei dem Forschungsprojekt „Multi-Immerse“ darum, schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen im Universitätsklinikum des Saarlandes virtuelle Besuche ihrer Angehörigen in einem speziellen digitalen Raum zu ermöglichen. VR-Brillen (VR steht für „Virtuelle Realität“) sind das wohl bekannteste Beispiel „immersiver Technologien“, mit deren Hilfe wir in virtuelle Welten eintauchen. Sie nutzen aus, dass sich das menschliche Gehirn – eigentlich ein erstaunliches Meisterwerk – relativ einfach austricksen lässt. Denn das Gehirn kann vieles, aber nicht in zwei unterschiedlichen Welten gleichzeitig sein. Wenn sich Menschen also eine dieser VR-Brillen aufsetzen, auf denen ein Strandfilm abläuft, dann haben sie irgendwann das Gefühl, am Strand zu sein, weil sie ja nichts anderes zu sehen und zu hören bekommen als einen Strand und das Geräusch von Wellen. Beim Sehen und Hören machen die Forschenden des CDNS allerdings nicht halt. Sie forschen mit vielen Tech-Partnern an multisensorisch-immersiven Technologien, das heißt, sie wollen uns eine leichte Brise am Strand auch noch fühlen und in Zukunft vielleicht sogar die Seeluft riechen lassen. Die psychosozialen Möglichkeiten dieser Technologie nutzt das Projekt „Multi-Immerse“ dazu, schwer erkrankten Kindern, die ihre Familien nicht treffen dürfen, bestmöglichen Ersatz zu bieten. Eine Alternative, die intensiver, unmittelbarer und sinnlich erfahrbarer ist als ein Videocall oder selbst ein Elternbesuch, bei dem sich die Familie doch in zwei unterschiedlichen Räumen aufhält und durch eine Fensterscheibe getrennt ist. Der therapeutische Nutzen ist evident: Stresshormone fallen in Anwesenheit der Eltern bei Kindern messbar ab, die Nähe ist ein Heilmittel.
„Informatiker etwa befassen sich mit der Frage, wie man die Berührung aufnimmt, und das Zentrum für Mechatronik mit der Weiterleitung an das Kind. Neurowissenschaftler optimieren die emotionale Erfahrung bei der übertragenen Berührung.“
Prof. Daniel Strauss, Sprecher des CDNS
„Um zu klären, ab welchem Alter der Einsatz sinnvoll ist, ist auch die Homburger Kinderpsychiatrie mit involviert“, fügt er hinzu. Das Projekt „Multi-Immerse“ wird derzeit in der Kinderklinik Homburg realisiert, soll im Anschluss aber auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens Anwendung finden.
Neurosensorik in Kombination mit KI als Frühwarnsystem
Auch bei dem Projekt „Digital Scrubs“ werden Medizin und Informatik eng miteinander verknüpft. Dabei sollen OP-Teams in Krankenhäusern künftig interaktive Assistenzsysteme zur Seite gestellt werden, die „Aufmerksamkeitsressourcen“ optimieren. Schon heute sind Operationen hoch technisierte, minutiös getaktete Prozesse in OP-Trakten voller Bildschirme. Der Ansatz „neues Gerät, neuer Bildschirm, neuer Alarmton“ verliert im Zusammenwirken mehrerer Geräte allerdings seine Effizienz. Auch führt die zunehmende Vernetzung innerhalb des OP zu mehr Daten, aus denen wertvolle Informationen zur Verbesserung des Eingriffs abgeleitet werden können. Der Nutzen dieser Informationen zur Verbesserung eines Eingriffs ist derzeit allerdings durch die Aufmerksamkeitsressourcen des OP-Teams beschränkt. Das Projekt „Digital Scrubs“ beschäftigt sich deshalb damit, wie relevante, KI-gestützte OP-Infos ans Chirurgieteam optimal übermittelt werden können und welche Vorteile es hätte, wenn Chirurginnen und Chirurgen ihre Sinne durch AR-Technologie erweitern würden. AR steht für „Augmented Reality“ und bedeutet „erweiterte Realität“, wobei die Forschung am CDNS neben den bekannten AR-Brillen auch das Multisensorische umfasst. Anders als bei VR-Brillen wird die Realität dabei nicht ausgeblendet, sondern AR ermöglicht es der oder dem Operierenden, mit hochauflösenden 3D-Scans ins Patienteninnere zu blicken. „Über die Brille zeigt die KI dem Chirurgen, wo er schneiden soll, auf Basis von Daten, die während der OP in Hochgeschwindigkeit ausgewertet werden“, erklärt Professor Daniel Strauss. Gleichzeitig soll KI auch eingesetzt werden, um individuell auf die kognitive und emotionale Verfassung des OP-Teams durch spezielle Neurosensorik, zum Beispiel in den OP-Kleidern, einzugehen. „Wenn der Chirurg visuell und akustisch belegt ist, weil er gucken muss, wo er schneidet, und auch noch mit dem OP-Team redet, muss die KI ihm anders mitteilen, dass er um Gottes Willen nicht weiterschneiden darf“, erläutert Professor Strauss. Das könnte zum Beispiel haptisch erfolgen: durch ein Vibrieren der Weste. Vereinfacht gesagt: Neurosensorik soll als Frühwarnsystem wirken und durch das „Aufmerksamkeits-Assistenzsystem“ OP-Fehler minimieren.
Materialwissenschaft und Biotechnologie verknüpft
Auch das INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien arbeitet interdisziplinär. Fachleute aus Materialwissenschaft, Physik und Chemie, aber auch aus der Biologie, Pharmazie und Medizin forschen unter anderem daran, Materialien so zu verändern, dass diese nützliche neue Eigenschaften annehmen: Zerkratzte Lacke heilen sich selbst, Kunststoffe erhalten die Transparenz von Glas und sind dennoch bieg- und knickbar, oder synthetisch hergestellte Materialien werden mit Eigenschaften von natürlichen, lebenden Zellen ausgestattet und dadurch anpassungsfähig und programmierbar gemacht. Ein wesentlicher Fokus der INM-Forschung liegt auf der Übertragung von biologischen Prinzipien auf das Design neuer Materialien, Strukturen und Oberflächen. Seit März 2023 erweitert und vertieft Professor Wilfried Weber mit seinem Fachgebiet, der materialorientierten synthetischen Biologie, das Forschungsspektrum des Instituts. Weber ist im Tandem mit Professorin Aránzazu del Campo Wissenschaftlicher Geschäftsführer des INM und zugleich Professor für Neue Materialien an der Universität des Saarlandes.
„Der große Vorteil von Organismen ist ihre Fähigkeit, zu spüren, was in ihrer Umwelt passiert, und sich daran anzupassen. Wir übertragen die dafür verantwortlichen biologischen Sensoren und Schalter in Materialien. Auf diese Art konstruieren wir neue Materialien, die ihre Eigenschaften auf die Umgebung abstimmen.“
Professor Wilfried Weber, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des INM und zugleich Professor für Neue Materialien an der Universität des Saarlandes
Sein Team setzt für die minutiöse Steuerung von Genen, Zellen und Materialien vor allem Licht ein und ist damit international führend auf dem Forschungsgebiet der molekularen Optogenetik. „Wir übertragen Mechanismen, wie Pflanzen auf Licht reagieren, in Zellen und diese wiederum in Materialien. So können wir die Eigenschaften der daraus entstehenden lebenden Materialien steuern. Wir sind zum Beispiel in der Lage, über Licht die Stabilität eines Materials zu programmieren“, erläutert Wilfried Weber. Grundsätzlich ist seine Forschung dabei auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. In einem seiner Projekte programmiert er Zellen so, dass aus Holzabfällen wie Sägespänen wieder neue Holzwerkstoffe entstehen – als biologisches Upcycling. Dass der renommierte Biotechnologe, der an der Universität Freiburg im Leitungsteam eines Exzellenzclusters mitwirkte, in das Saarland gewechselt ist, liegt für ihn in der Stärke und Vielfalt des Saarbrücker Forschungsstandortes begründet: „Die kurzen Wege und die kollegiale Zusammenarbeit über Fächergrenzen und Institute hinweg sind eine der großen Stärken des Saarbrücker Campus.“ Ein Beispiel hierfür ist der Leibniz Science-Campus „Lebende Therapeutische Materialien“. Hier bündeln das INM, die Saar-Universität und das Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) ihre Expertise, um ganz spezielle lebende Materialien zu entwickeln, die Arzneistoffe produzieren und diese maßgeschneidert und kontrolliert in den menschlichen Körper abgeben. „Mit diesem multidisziplinären Forschungsprogramm ist Saarbrücken international führend auf dem Gebiet der lebenden Materialien. Es gibt in Europa nur zwei weitere große Standorte in diesem stark wachsenden Forschungsfeld.“
Das könnte Sie auch interessieren:
Interview mit Prof. Volkamer „Dem perfekten Wirkstoff auf der Spur“
Connected Intelligence
Partner
Das Saarland
Arbeiten, Leben und Netzwerken im Saarland: Wo Tradition auf Innovation trifft
„Liebe Leserinnen und Leser, ich lade Sie ein: Lassen Sie sich auf das Saarland ein. Wer einmal hier war, kommt wieder. Oder bleibt gleich für immer.“
Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes
Das Saarland, eine Region mit erstaunlicher wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Vitalität, bietet weit mehr, als man vielleicht vermutet. Hier genießen die Menschen nicht nur eine hohe Lebensqualität, sondern es bieten sich ihnen unzählige Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung sowie ein reiches Angebot an Kunst und Kultur. Im Herzen Europas gelegen, inmitten reizvoller Landschaften und in unmittelbarer Nachbarschaft zu langjährigen Partnern wie Frankreich und Luxemburg, wird das Saarland nicht selten als das europäischste aller Bundesländer bezeichnet. Es verbindet seine reiche Industriegeschichte mit modernen Arbeitsmöglichkeiten und einer innovativen Geschäftswelt. Darüber hinaus zeichnet sich das Saarland durch eine beeindruckende Wandlungsfähigkeit aus. Hier gestalten Wissenschaft und Wirtschaft aktiv die Zukunft – ob Digitalisierung oder grüne Energie. Das Saarland treibt moderne Technologien und wegweisende Veränderungen voran. Einzigartig ist die Möglichkeit, in nur zehn Minuten von jedem Schreibtisch in die Natur zu gelangen. Vor allem aber machen die Menschen das flächenmäßig kleinste Bundesland zu einem Ort gelebter Willkommenskultur mit starkem Zusammenhalt und einem einzigartigen Lebensgefühl, dem „Saarvoir-Vivre“. Vom ersten „Willkommen“ bis zum entschlossenen „Willbleiben“ ist es da nur ein kleiner Schritt. Fach- und Führungskräfte, aber auch junge Familien finden hier ideale Startbedingungen für ihre berufliche und persönliche Entwicklung.
Aus Spitzenforschung wird Wirtschaftsleistung
Zudem setzt das Land auf den Transfer technologischer Innovationen in die Unternehmen vor Ort: Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Mobilität, grüner Stahl, Lifescience, Digitalisierung, Cybersicherheit und KI sind entscheidende Zukunftsthemen der ökonomischen Transformation an der Saar. Sowohl Investoren als auch Fachkräfte schätzen die Stärken des Standortes, die optimalen Bedingungen, die kurzen Wege, die Netzwerke sowie die spannenden Perspektiven. Entdecken Sie das Saarland mit seinen vielfältigen Karrierechancen, starken Netzwerken sowie der hohen Lebensqualität und gestalten Sie mit uns aktiv den Wandel der Region.
Das könnte Sie auch interessieren:
Lifesciences
Grüner Stahl
Startups
Nachhaltige Mobilität
Conntected Intelligence
Weltraumforschung
Magazinbeitrag: Arbeiten, Leben und Netzwerken im Saarland
Die grüne Zukunft des Stahls – made in Saarland
Einst stand das Saarland für Stahl und Kohle, für Industrialisierung und Wirtschaftswunderzeit. Jetzt startet die Stahlindustrie das größte Projekt ihrer Geschichte: die grüne Transformation. Schon in wenigen Jahren werden Koks und Kohle durch Wasserstoff und Elektrizität ersetzt. Und das Saarland wird zum „grünen“ Industriestandort.
Der Beginn einer neuen Ära in der Stahlherstellung
„Unsere Stahlindustrie wird grün – konsequenter als irgendwo sonst in Europa. Dafür werden Milliarden investiert. Doch jeder Euro ist in den Erhalt der Arbeitsplätze und unseres Klimas gleichermaßen investiert.“
Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes
An der Saar förderten einst Zehntausende Bergleute jenen Rohstoff, der in Dutzenden Hochöfen im Saarland zu Eisenerz und Roheisen verhüttet wurde: die Kohle. Seit einem Jahrzehnt sind die Gruben geschlossen, die saarländische Stahlindustrie konnte hingegen die Produktivität steigern, blieb wettbewerbsfähig und konnte ihre Standorte erhalten. Heute ist sie mit ihren Spitzenprodukten (heimischer) Zulieferer für den Maschinenbau und die Autoindustrie; für Produzenten von Windrädern und bei vielen anderen Produkten ist sie gut positioniert.
Nun geht die Stahlindustrie den nächsten Schritt: die Transformation zum grünen Stahl. Es ist ein großes und komplexes Projekt, das sich auf das gesamte Saarland auswirken wird – und neue Chancen bringt. Seit Jahrtausenden verhütten die Menschen Eisenerz bei hohen Temperaturen und unter Zusatz von Kohle. Auch wenn sich die Herstellung technologisch in vieler Hinsicht weiterentwickelt hat, ist ein Aspekt geblieben, der nicht akzeptabel ist – der hohe Ausstoß an Treibhausgasen. Innerhalb der industriellen Fertigung ist die Stahlindustrie für ein Viertel der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich und für nahezu ein Zehntel der Gesamtemissionen. Doch die Stahlhersteller unter dem Dach der SHS – Stahl-Holding-Saar, die Saarstahl AG und die Dillinger Hütte, werden das ändern. Denn Stahl bleibt ein Zukunftsstoff, seine Produktion wird nunmehr nachhaltiger erfolgen. Weg von der Kohle, hin zum Wasserstoff: Investitionen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro sorgen an den Standorten in Völklingen und Dillingen dafür, dass die Geschichte der Stahlherstellung im Saarland neu geschrieben wird. Im vergangenen Dezember sagten Bund und Land für das Projekt Fördermittel in Höhe von 2,6 Milliarden Euro zu.
Einsatz von Wasserstoff soll Millionen Tonnen von CO2 einsparen
„Wir werden künftig über eine sogenannte Direktreduktionsanlage und zwei Elektrolichtbogenöfen produzieren. Damit gehen wir in eine neue, umweltfreundlichere Ära der Stahlherstellung.“
Stefan Rauber, Vorsitzender der Geschäftsführung der SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA und Vorstandsvorsitzender der beiden Stahlunternehmen Dillinger und Saarstahl AG
In Dillingen werden die klassischen Hochöfen ab 2027 durch eine sogenannte Direktreduktionsanlage zunächst ergänzt und später ersetzt. Solche Anlagen brauchen keine Kohle und stoßen signifikant weniger Kohlendioxid aus. Denn um den in Eisenerz und Eisenschrott gebundenen Sauerstoff herauszulösen, also zu reduzieren, wird dort in Zukunft Wasserstoff eingesetzt. Auch um die Hitze zu erzeugen, die zum Einschmelzen des Eisens nötig ist, wird keine Kohle mehr verbrannt. Dazu dienen in Zukunft elektrisch betriebene Öfen, die ebenfalls ab 2027 in Völklingen und Dillingen eingesetzt werden. Dank des Einsatzes der beiden Techniken sollen jährlich bis zu 3,5 Millionen Tonnen CO2-armer Stahl hergestellt werden. Da bei jeder Tonne herkömmlich produzierten Stahls die eineinhalbfache Menge an CO2 anfällt, werden damit 4,9 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Damit wird eine komplett neue grüne Wertschöpfungskette geschaffen. Und diese Investitionen sorgen auch dafür, Ausbildungs- und Arbeitsplätze im Saarland zu erhalten. Der emissionsfrei erzeugte Wasserstoff, der für die grüne Stahlproduktion benötigt wird, ist allerdings noch nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar. Dies ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass die Transformation in zweifacher Hinsicht nachhaltig gelingt: in ökologischer wie ökonomischer. Deshalb baut die Stahlindustrie gemeinsam mit den lokalen Energieversorgern die Produktion direkt vor Ort im Saarland auf. Mit dem Leitungsprojekt „mosaHYc“ beabsichtigen die Gasnetzbetreiber Creos Deutschland und GRTgaz (Frankreich) eine ca. 85 km lange, grenzüberschreitende Wasserstoff-Leitung von Carling bis Perl und von Thionville bis Dillingen. Im Projekt HydroHub Fenne ist durch die Iqony GmbH zudem der Aufbau eines 53-MW-Elektrolyseurs am Kraftwerksstandort in Völklingen geplant.
Nach der beihilferechtlichen Genehmigung der EU-Kommission von Mitte Februar haben die beteiligten Mitgliedsstaaten nun grünes Licht für die Umsetzung. In Perl soll z. B. die Produktion im 70-Megawatt-Elektrolyseur 2026 beginnen, mit 7.000 Tonnen pro Jahr. Aus Wasser aus der Mosel, Strom aus Wind- und Sonnenkraft entsteht dann im Elektrolyseur grüner Wasserstoff. Per Pipeline wird er zu den Stahlwerken nach Dillingen und Völklingen transportiert.
Zukunftsweisend für die internationale Energie- und Mobilitätswende
Die grüne Stahlherstellung ist ein wichtiger Schritt für das Saarland und darüber hinaus. Denn Stahl ist die Basis für zwei noch größere, gesamtgesellschaftliche Projekte: die Energie- und die Mobilitätswende. Für Elektroautos und öffentliche Verkehrsmittel, für Windkraftanlagen, Solarparks und moderne Gebäude liefert die saarländische Stahlindustrie essenzielle Produkte in hoher Qualität. Und das in Zukunft CO2-neutral. Der technologische Vorsprung kann sich als der nächste Exportschlager des Saarlandes entpuppen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Interview mit Reinhard Störmer und Stefan Rauber: Wir gehen in eine neue Ära der Stahlherstellung
Nachhaltige Mobilität
Lokale Unternehmen und Organisationen:
Startup-Szene: Brutkasten für Innovation und Unternehmergeist
Im Saarland pulsiert eine aufstrebende Startup-Szene. Mit einem starken Netzwerk aus Universitäten, Forschungsinstituten und etablierten Unternehmen bietet die Region beste Bedingungen für innovative Gründerinnen und Gründer. Von Technologie bis hin zu sozialen Innovationen entstehen wegweisende Unternehmen, die die Zukunft gestalten. Die Unterstützung durch Inkubatoren, Förderprogramme und Mentoren macht das Saarland zu einem attraktiven Hub für Unternehmertum und Innovation. Entdecken Sie hier einige der spannenden Ausgründungen:
Andreas Maurer und Heidi Houy haben KeepLocal gegründet und sind mit ihren lokalen Gutscheinen bei Globus vertreten.
Wer nicht weiß, was er schenken soll, greift oft zum Gutschein. Das sind allerdings meist Gutscheine für internationale Konzerne oder Onlinehändler. „Das Geld geht der regionalen Wertschöpfung sofort verloren, raus aus Deutschland, aus Europa. Das ist schade“, sagt Andreas Maurer, der zusammen mit Heidi Houy ein regionales Gutscheinsystem namens KeepLocal gegründet hat.
Die Idee haben Houy und Maurer Anfang 2019 auf einem Unternehmertreffen in Sankt Wendel entwickelt – auf einer Müslipackung. Die Besitzerin einiger Modehäuser im Ort fragte sich, warum man an der Kasse im Drogeriemarkt nicht auch Gutscheine von Händlern im Ort kaufen kann, IT-Unternehmer Maurer wusste gleich, wie dieses Problem zu lösen ist. Das Startup bietet eine Plattform für den Kauf der Gutscheine. Wenn diese eingelöst werden, wird das Geld an den Onlinehandel überwiesen. Am Rest verdient KeepLocal. Die Einlöserate sei bei den Regiogutscheinen recht hoch, sagt Maurer, mittelfristig rechnet er mit zehn Prozent, die nicht eingelöst werden. Inzwischen gibt es alleine im Saarland mehr als 1000 Akzeptanzstellen. Nächstes Ziel: nationale Verfügbarkeit. „Wir werden nicht das Allheilmittel sein, um die Innenstädte zu retten, aber wir können einen Beitrag dazu leisten“, sagt Maurer. Der Gutscheinmarkt in Deutschland hat schon jetzt einen Umsatz von zehn Milliarden Euro, das Potenzial ist riesig. KeepLocal will dafür sorgen, dass aus einem Notfall-Geschenk echter Mehrwert für die Regionen entsteht – dafür wurde die Firma auch im vergangenen Jahr als Landessieger Saarland mit dem KfW-Award Gründen ausgezeichnet.
Erysense von Cysmic ist ein Point-of-Care-Blutanalysegerät, das Lab-on-Chip-Technologie, Bildgebung und KI vereint und kaum größer als eine Espressomaschine ist.
Erysense sieht ein bisschen aus wie eine bekannte Espresso-Kapsel-Maschine, kann aber so viel mehr: Das Gerät ist ein Minilabor samt Mikroskop, das den Blutfluss im Körper des Menschen simuliert, dabei rote Blutzellen analysiert und so unter anderem die Qualität von Blutkonserven überprüfen kann. Dahinter steckt ein ganzes Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die größtenteils von der Universität des Saarlandes stammen. Sie haben einen Kunststoffchip entwickelt, der winzige Mikrokanäle enthält, und ein Verfahren, rote Blutzellen auf diesen Kanälen zu analysieren.
Rote Blutzellen sind in der Lage, sich stark zu deformieren, um Sauerstoff in jeden Winkel des Körpers transportieren zu können. Sind sie geschädigt, gelingt das weniger gut. Dank Cysmics Verfahren können Auffälligkeiten im Blut frühzeitig festgestellt werden. „Das befähigt uns, Qualitätskontrollen von Blutkonserven durchzuführen“, sagt Dr. Stephan Quint, einer der Gründer von Cysmic. Die große Hoffnung dabei: Aktuell müssen alle nicht eingesetzten Blutkonserven nach 42 Tagen entsorgt werden – auch wenn diese noch länger halten würden. Mithilfe von Erysense können Blutkonserven hingegen spenderspezifisch bewertet werden. „Wir hoffen, so bis zu 20 Prozent mehr Blut im Markt halten zu können“, sagt Quint.
IS Predict: KI-Vorreiter aus Saarbrücken
Gemeinsam haben Richard Martens und Britta Hilt das KI-Unternehmen IS Predict gegründet. Schon 2010 bot das Saarland dafür ein attraktives Umfeld.
Effiziente Prozesse für Mensch, Maschine, Material und Energieeinsatz zu gestalten – so lautet das Versprechen des auf KI spezialisierten Softwareunternehmens IS Predict aus Saarbrücken. „Unser Ziel ist es, uns als Vorreiter für innovative und leistungsstarke KI-Lösungen zu etablieren“, sagt Britta Hilt, Managing Director und Co-Founder des 2010 gegründeten Unternehmens.
Das Saarland habe ein attraktives Umfeld für das damalige KI-Startup geboten, so Hilt. „An der Uni in Saarbrücken gibt es seit vielen Jahrzehnten das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), das weltweit einen guten Ruf hat.“ Es gebe zahlreiche Hilfestellungen bei einer Gründung. Zudem nutze IS Predict heute als erfolgreiches Unternehmen diverse Forschungskooperationen. Dabei könne jeder Partner seine spezifische Expertise einbringen.
Surfunction: Hürden für die Kreislaufwirtschaft überwinden
Prof. Dr. Frank Mücklich (links) und Surfunction-CEO Dr. Dominik Britz zeigen am Ionenstrahl-Mikroskop eine bioinspirierte Oberfläche, mit der enorme Energieeinsparungen erreicht werden können.
Die Umsetzung der Circular Economy muss sowohl zur Senkung des Ressourcenverbrauchs als auch für unsere bestmögliche wirtschaftliche Resilienz und technologische Unabhängigkeit vorangetrieben werden. Dabei spielt ein neuer Ansatz zur Werkstoffoptimierung eine wichtige Rolle. Professor Frank Mücklich, Direktor des Material Engineering Centers Saarland an der Universität des Saarlandes und Sprecher für die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech), erklärt dazu: „Die Energiewende ist auch eine Materialwende, bei der wir eine enorm gestiegene chemische Diversität der Hochleistungswerkstoffe einsetzen. Für eine erfolgreiche Entwicklung bis zur Circular Economy muss dabei unbedingt von Anfang an auch die Möglichkeit der späteren effizienten Wiederauftrennung komplexer technischer Produkte in die Einzelwerkstoffe bereits bei der Werkstoffentwicklung und der Systemkonstruktion mitgedacht werden.“
Beispielsweise werden derzeit noch vielfältigste funktionelle Beschichtungen eingesetzt, die das spätere Recycling massiv behindern. Das ökologisch innovative saarländische Startup Surfunction beweist mit seiner bioinspirierten DLIP-Lasertechnik zur maßgeschneiderten Oberflächenfunktionalisierung ganz ohne Chemie, dass völlig neue technologische Wege zur konsequenten Circular Economy möglich und notwendig sind.
ICC: Unternehmer gehen soziale Missstände an
Die Energiewende vorantreiben und soziale Missstände in der Welt unternehmerisch lösen: Das haben sich Daniel Gluche und Chris Koch auf die Fahnen geschrieben.
Mit dem Ende 2021 gegründeten sozialen For-Profit-Unternehmen ICC GmbH setzen sich Christian Koch und Daniel Gluche im Bereich Flächensicherung für Solarkraftwerke und Energiespeicher sowie im Bereich Kunststoffrecycling für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in Deutschland sowie Ostafrika ein – und bekämpfen durch das Schaffen von Arbeitsplätzen Fluchtursachen in Afrika. „Wir arbeiten gerade am Aufbau eines Netzwerkes industrieller Spritzgussproduzenten. Damit können wir Kunststoffprodukte von Handelsunternehmen durch 100 Prozent Rezyklat substituieren“, erläutert Koch. Damit werde die Kreislaufwirtschaft vorangebracht. Die entstehenden Gewinne dienen wiederum zum Teil dazu, Partner in Ostafrika bei der Realisierung eigener Startups im Bereich Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.
Das könnte Sie auch interessieren:
Weitere innovative Startups gibt es unter: Saarland Startup Ecosystem – first:stop:shop
Lokale Unternehmen und Organisationen:
Vorreiter für nachhaltige Mobilität
Menschen wollen mobil sein. Doch mit Blick auf Klimaschutz und Umwelt sind Kraftfahrzeuge von der Herstellung über den Betrieb bis zur Entsorgung Sorgenkinder. Das muss aber nicht so bleiben. Klimaschutz und der schonende Umgang mit Ressourcen sollen bei Autos und anderen Verkehrsmitteln zukünftig im Fokus stehen. Im Saarland wird an Ideen geforscht, an innovativen Produkten, Verfahren und ganzen Fabriken gearbeitet, um das Auto nachhaltiger zu machen. Einige zukunftsweisende Beispiele aus dem Saarland:
Forschung: Recycling-Kunststoffe mit eingebauter Nachhaltigkeit
Ein Spezialist für Nachhaltigkeit ist Professor Christoph Wittmann, Leiter des Instituts für Systembiotechnologie an der Universität des Saarlandes. Er forscht und arbeitet in einem Fachgebiet, das näher am Alltag ist, als viele glauben. Mikroorganismen dienen seit Jahrtausenden still und fleißig bei der Herstellung von Joghurt, Sauerkraut, Wein oder Brot. Was dabei abläuft, ist jedoch äußerst komplex, und dieser Komplexität will die Systembiotechnologie gerecht werden.
„Wir gehen ganzheitlich heran und versuchen, systematisch zu verstehen, wie die Zellen funktionieren, wie sie gebaut sind und wie wir ganz gezielt eingreifen können, um den Stoffwechsel zu lenken.“
Professor Christoph Wittmann, Leiter des Instituts für Systembiotechnologie an der Universität des Saarlandes
„Beispielsweise können wir mithilfe der Gentechnik bestimmte Funktionen von Zellen gezielt verändern und sie damit in nachhaltige Synthesefabriken verwandeln.“ Dieses Wissen setzen Wittmann und sein Saarbrücker Forschungs-Team im EU-Projekt RE Purpose ein, um aus Abfällen nachhaltige Kunststoffe herzustellen. So sollen langfristig die herkömmlichen auf Basis von Erdöl hergestellten Materialien ersetzt werden. Insgesamt elf europäische Partner sind an dem Projekt beteiligt, die mit ihrer Expertise die gesamte Kette abdecken – von der Produktion bis zum Recycling. Um Kunststoffe zu entwickeln, die sich abbauen und ohne Qualitätsverlust recyceln lassen, setzen die Saarbrücker Systembiologinnen und -biologen auf zwei Ansätze, die gemeinsam wirken sollen. Die Abfälle werden mit speziellen Enzymen vorbehandelt, von eigens entwickelten Bakterien abgebaut und zugleich in das gewünschte neue Material umgewandelt. „Am Ende haben wir die denkbar ökologischsten Kunststoffe, die ohne Petrochemie hergestellt wurden, kontrolliert abbaubar sind und unbegrenzt recycelt werden können“, sagt Wittmann. Nach Metallen stehen Kunststoffe an zweiter Stelle der in Autos verbauten Materialien, mit seit Jahren steigender Tendenz. Hinzu kommt, dass das Thema Nachhaltigkeit alle Hersteller umtreibt, von Audi über BMW und Mercedes-Benz bis Volkswagen. Für den Saarbrücker Forscher gibt es daher in der Branche klares Potenzial für seine Produkte: „Konsumenten wollen sich heute mit nachhaltigen Produkten umgeben. Da wäre das Auto, das ohnehin in dieser Hinsicht kritisch betrachtet wird, ein idealer Ort für unsere Kunststoffe.“
Wolfspeed plant Chipfabrik für die Zukunft der Elektromobilität
Nachdem sich Europa bei Computerchips jahrzehntelang überwiegend auf asiatische Hersteller verlassen hat, wird mit Hochdruck an der Rückkehr eines Teils der Produktion gearbeitet. Denn die Bauteile sind derzeit knapp, was beispielsweise bei Autoherstellern zu Produktionsausfällen geführt hat. Die Nachricht von einer geplanten Chipfabrik im saarländischen Ensdorf wurde deshalb von Wirtschaft und Politik bis hinauf zum Wirtschaftsminister und Kanzler begeistert begrüßt. Anfang Februar 2023 hatte der US-amerikanische Hersteller Wolfspeed angekündigt, dort, wo einst Kohle zu Strom wurde, die „weltweit größte und modernste“ Produktion für Siliziumkarbid-Halbleiter aufbauen zu wollen, und damit auch eine Investition von zwei Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. „Wir haben uns einfach ins Saarland verliebt“, sagte Wolfspeed-CEO Gregg Lowe auf die Frage nach der Standortwahl und fügte hinzu, es biete sich eine überzeugende Kombination aus hoch qualifizierten Arbeitskräften, hervorragender Infrastruktur, Zugang zu großen Märkten mit wichtigen globalen Industrieunternehmen, einer zentralen Lage in Europa und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit. „Darüber hinaus unterstützen die deutsche Bundesregierung und die saarländische Landesregierung unsere Idee, ein historisches Kohlekraftwerk in eine Hightech-Anlage für eine energiesparende Zukunft umzuwandeln“, so Lowe. Siliziumkarbid ist ein weltweit begehrtes Material, das insbesondere bei der Elektromobilität eine große Rolle spielt. Es leitet elektrischen Strom besser, schaltet schneller und reduziert die Verluste von Energie, die als Wärme verloren geht.
„Einfach ausgedrückt: Ein Elektroauto lädt schneller auf, fährt weiter und bietet mehr Platz, wenn es mit Halbleitern auf Siliziumkarbid-Basis ausgestattet ist.“
Gregg Lowe, Wolfspeed-CEO
Wolfspeed möchte in Ensdorf die nächste Generation von Hochleistungs-Siliziumkarbid-Chips fertigen. Hochautomatisiert soll dies auf sogenannten Wafern, mikroelektronischen Grundplatten, mit 200 Millimeter Durchmesser geschehen. Dies steigert im Vergleich zu den bisher üblichen 150-Millimeter-Wafern die Chip-Ausbeute und senkt damit Produktionskosten. Wolfspeed hat dabei einen prominenten deutschen Partner: Mit einem dreistelligen Millionenbetrag will sich der Technologiekonzern ZF an der Fabrik beteiligen und plant außerdem die Gründung eines gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Siliziumkarbid-Systeme. Für ZF-Vorstandsmitglied Stephan von Schuckmann vereinen beide Unternehmen auf branchenweit einmalige Weise Kompetenz in Leistungselektronik und elektrischen Systemen mit dem Know-how in den Anwendungen. „Wolfspeed bringt seine mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Siliziumkarbid-Technologie ein, und bei ZF haben wir ein einzigartiges Verständnis für die Gesamtsysteme in allen Branchen – von Pkw und Nutzfahrzeugen bis hin zu Baumaschinen, Windenergie und industriellen Anwendungen.“
Bosch entwickelt Spezialteile für die wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle
In Homburg, auf halbem Weg zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern, liegen drei Werke der Robert Bosch GmbH mit rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben anderen Geschäftsbereichen wird im größten Werk an einer Technologie gearbeitet, die für die Mobilität der Zukunft eine große Rolle spielen könnte: die Brennstoffzelle. Vereinfacht gesagt, wandelt sie Wasserstoff und Sauerstoff in elektrischen Strom um, wobei als Abfallprodukt nur Wasser entsteht. Bereits seit den 1960er-Jahren als Stromquelle für Raumschiffe und Satelliten eingesetzt, wird die Technik nun immer mehr alltagsfähig. Zwei Faktoren wirken für Dr. Michael Reinstädtler, der bei Bosch in Homburg die Fertigungsentwicklung der Brennstoffzelle leitet, dabei beschleunigend: die Klimakrise und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Der Abschied von fossilen Brennstoffen kommt schnell.
Im Vergleich zur Batterie habe die Brennstoffzelle einen entscheidenden Vorteil: Sie lässt sich viel schneller laden, ein Wasserstofftank ist in Minuten gefüllt. Zudem ließe sich eine für Lastwagen nötige Wasserstoffinfrastruktur weitaus schneller und günstiger aufbauen als eine für elektrisches Schnellladen. „Lastwagen brauchen dafür eine Ladeleistung im Megawattbereich. Die nötige Infrastruktur wird es an Autobahnraststätten, wo Hunderte Lkw täglich tanken, lange nicht geben“, ist Reinstädtler sicher. Und Pkw? Natürlich wäre auch das ein attraktiver Absatzmarkt. „Aber die Wasserstoffmobilität wird sich zunächst bei Fahrzeugen ab einem Gewicht von sechs Tonnen durchsetzen“, erläutert er. Und ist sicher: „Ab 2035 wird die Hälfte dieser Fahrzeuge entweder eine Batterie oder eine Brennstoffzelle an Bord haben.“
Materialien aus alten Autoreifen
Ob Pkw oder Lkw – alle brauchen Reifen, viele nur vier, einige acht, andere bis zu 16 Stück. Haben diese das Ende ihrer Lebenszeit erreicht, müssen sie entsorgt werden, und die Menge an Altreifen erreicht geradezu unglaubliche Ausmaße. Allein in Deutschland fallen jährlich über 600.000 Tonnen davon an, und ihre Entsorgung oder Wiederverwertung ist ein kniffliges Problem. Deshalb landet bisher ein großer Teil der Reifen als Brennstoff in Zementwerken, andere werden zu Blumenkübeln, Parkbänken oder Bodenbelägen für Sport- und Spielplätze. Dass es dafür eine bessere Lösung gibt, zeigt die Pyrum Innovations AG, ein Startup im saarländischen Dillingen. Dem Team um Mitgründer und Vorstand Pascal Klein gelingt das Recycling von Altreifen per Thermolyse, der Aufspaltung organischer Verbindungen bei hohen Temperaturen.
„Viele versuchen sich daran, aber keiner hat es so gut hinbekommen wie wir“, erzählt Klein und zeigt in seinem Büro auf eine Reihe von kleinen Behältern, die das enthalten, was nach der Thermolyse vom Reifen übrigbleibt: Gummigranulate in verschiedenen Mischungen und Korngrößen, Pyrolyse-Öl, Ruß und schließlich Stahldraht – nicht umsonst heißen Autoreifen seit den 1960er-Jahren auch „Stahlgürtelreifen“.
Pascal Klein, Mitgründer und Vorstand von Pyrum Innovations AG
Abnehmer gibt es bereits: Beispielsweise stellt der Chemieriese BASF mit Recyclat von Pyrum einen Kunststoff her, den Mercedes-Benz in Fahrzeugen verwendet. Die Idee zur Thermolyse ist nicht neu, wurde aber bei Pyrum über viele Jahre verfeinert. „Wir haben einen Reaktor entwickelt, der bei hohen und stabilen Temperaturen im Vakuum die Abfälle in ihre Bestandteile zerlegt und dabei im Unterschied zu anderen Lösungen lange läuft“, erklärt Klein. „Diese Anlage hier“, und dabei deutet er aus dem Fenster auf die Anlage im Hof, „ist seit Mai 2020 in Betrieb, also seit drei Jahren, 24 Stunden am Tag.“ Abgesehen vom Schreddern der Abfälle, das Energie kostet, entsteht bei der Thermolyse im Reaktor als Nebenprodukt brennbares Gas. „Das erlaubt es uns, die Anlage energieautark zu betreiben, es entsteht sogar ein Überschuss an Wärme, den wir weiterverkaufen können.“ Erlöse aus dem Verkauf der Recyclingprodukte, energetisch nahezu autark – das klingt wie ein Selbstläufer, wie etwas, auf das nicht nur die Recycling-Welt gewartet hat. Aber Klein, dessen Unternehmen seit September 2021 börsennotiert ist, bleibt auf dem Boden der Tatsachen. Jede Anlage kostet rund 40 Millionen Euro, vorfinanzieren kann Pyrum das selbst nicht. „Interessenten gibt es genug, aber für die Finanzierung brauchen diese eine Bank. Und die müssen wir immer noch davon überzeugen, dass unser Produkt nicht nur eine gute Recyclinglösung, sondern auch ein gutes Geschäft ist“, sagt Klein. Erkannt hat dies auch die BASF, die nicht nur am Startup beteiligt ist und mit einem Darlehen unterstützt, sondern auch großer Abnehmer des produzierten Öls ist. Somit konnte auch der neue Pyrolysereaktor 2 am Stammwerk in Dillingen zu Beginn dieses Jahres die ersten Testfahrten erfolgreich beenden und das erste Pyrolyse-Öl produzieren, das an BASF geliefert wurde. Die erste Testfahrt des dritten Reaktors soll Ende März 2024 beginnen. Mit den beiden neuen Reaktoren soll eine Verdreifachung der aktuellen Produktionskapazitäten erreicht werden. Und der Ausbau geht weiter: Bis Ende 2025 soll in Perl-Besch ein neues Pyrolysewerk mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr entstehen. Darüber hinaus sind derzeit weitere Werke im In- und Ausland geplant, darunter in Griechenland, Tschechien und Schweden.
Das könnte Sie auch interessieren:
Grüner Stahl
Lokale Unternehmen und Organisationen:
Connected Intelligence
Mit der Bündelung von Wissenschaft, Technologie und Industrie auf kleinster Fläche setzt das Saarland auf technologische Exzellenz in Megatrends wie Konnektivität und Künstliche Intelligenz.
Konnektivität ist ein Megatrend unserer Zeit. Ohne die digitale Vernetzung abseits von Raum und Zeit wäre vieles von dem, was für uns heute normal ist, kaum vorstellbar. „Connected Intelligence“ bedeutet, dass viele intelligente Systeme im Hintergrund zusammenwirken. „Wenn etwa Drohnen bei der Versorgung von Erdbebenopfern helfen oder Päckchen ausliefern, wirkt da ein komplexes System von Systemen zusammen“, sagt Bernd Finkbeiner, Faculty am CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit und Professor für Informatik an der Universität des Saarlandes. „Die Drohnen treffen Entscheidungen und tauschen sich aus, etwa bei Informationen über Wetter oder zur Bodenbeschaffenheit.“ Das muss auf eine zuverlässige Art und Weise geschehen, damit beispielsweise der Ausfall einer bestimmten Kommunikationsverbindung nicht das Gesamtsystem betrifft.
„Cybersicherheit und die Verbindung mit Künstlicher Intelligenz sind heute ganz zentrale Themen.“
Prof. Bernd Finkbeiner, Faculty am CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit und Professor für Informatik an der Universität des Saarlandes
In den geopolitisch unsicheren Zeiten, in denen wir leben, sei Cybersecurity noch wichtiger geworden. Das CISPA hat sich dabei zu einem der weltweit führenden Kompetenzzentren für die Sicherheit von Betriebssystemen und Hardware, insbesondere bei der Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen, entwickelt. Obwohl noch ein junges Forschungszentrum, ist das CISPA in diesem speziellen Bereich der Cybersecurity weltweit führend. Das belegt auch der eigens für das CISPA aufgesetzte Risikokapitalfonds des international agierenden Nachhaltigkeitsfonds Sustainable & Invest GmbH aus Frankfurt. Das private Risikokapital von bis zu 50 Millionen Euro ermöglicht es jungen Unternehmerinnen und Unternehmern im Saarland, ihre innovativen Ideen voranzutreiben. „Für uns ist es wichtig, nicht nur Grundlagenforschung zu betreiben, sondern auch in die Wertschöpfung zu dringen“, sagt Finkbeiner.
Wissenschaft und Industrie arbeiten im Saarland eng zusammen
Denn nur wenn Wissenschaft, Forschung und Industrie nahtlos zusammenwirken, können exzellente Lösungen entstehen, die dann für nachhaltige Sicherheit sorgen, sei es in Flugzeugen oder in IT-Netzwerken von Unternehmen, Behörden, Kraftwerken oder Krankenhäusern. Wie ein solches Cluster mustergültig funktioniert, beweist das Saarland. Mit seiner Bündelung von Wissenschaft und Technologie auf kleinster Fläche setzt man hier auf technologische Exzellenz in Megatrends wie Konnektivität und Künstlicher Intelligenz. Auf dem CISPA Innovation Campus in St. Ingbert entsteht in den kommenden Jahren ein Ballungs- und Kristallisationszentrum für Ausgründungen und Ansiedlungen namhafter Großunternehmen in den Bereichen Informatik, Cybersicherheit und verwandten Themen. Das CISPA liefert Gründerinnen und Gründern perfekte Arbeitsbedingungen und den Unternehmen wissenschaftliches Know-how, Reputation und Fachkräfte. Im Gegenzug kann das CISPA seine Forschung in die Anwendung bringen.
„Für die Region wird durch die entstehenden Arbeitsplätze Wohlstand und Wertschöpfung generiert.“
Prof. Michael Backes, CISPA-CEO und Gründungsdirektor
Die IHK Saarland prognostizierte jüngst in einer Studie für die Zukunft allein durch die zu erwartenden CISPA-Ausgründungen regionalwirtschaftliche Effekte von 133 Millionen Euro jährlich. Backes hat sich nicht weniger vorgenommen, als das CISPA zu einem „schlagenden Herzen des Strukturwandels im Saarland“ zu machen.
Rückenwind von der Stanford-Universität
Die ambitionierten Pläne verwundern nur auf den ersten Blick. Denn wie sonst kaum in Deutschland wirken industrielle Produktion, Wissenschaft und Politik so eng zusammen wie im Saarland. An Themen wie Konnektivität und Künstlicher Intelligenz, die heute mit ChatGPT ihren „iPhone-Moment“ haben, forscht man an der Saar bereits seit Jahren. Als Produktions- und Autoland ist es im Saarland seit Langem sinnvoll, sich intensiv mit KI zu beschäftigen. Bei der Vernetzung von Maschinen, Geräten und Sensoren, die unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ eine Erfolgsgeschichte der Wirtschaft in Deutschland darstellt, war das Saarland Pionier. Und so findet sich hier eine in seiner Dichte rare Kombination von exzellenten Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit Kompetenzen in den Bereichen Hardware, Software und Konnektivität – also den wesentlichen Treibern für die Realisierung von Industrie-4.0-Konzepten. Für Exzellenz auf Top-Niveau sorgt dabei das CISPA-Stanford-Programm. Die kalifornische Elite-Universität hat Absolventen wie die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, Netflix-Gründer Reed Hastings und Elon Musk hervorgebracht. „Im Rahmen des CISPA-Stanford Center for Cybersecurity forschen und lehren CISPA-Forscher als Gastprofessoren in Stanford“, sagt Finkbeiner, der selbst 2003 an der Stanford-Universität promovierte. „Unsere Forscher bleiben dort für zwei Jahre und kehren dann als Gruppenleiter ans CISPA zurück.“
Datenanalyse mit KI beschleunigen
Firmengründungen im Tech-Bereich sind im Saarland häufig Spinoffs aus Universitäten. Ein Beispiel ist Natif.ai. Das Startup analysiert mit Hilfe von KI-Modellen Daten von Banken, Anwaltskanzleien und Versicherungen extrem schnell und genau. „Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, die Welt vom Papierkram zu befreien“, sagt Natif.ai-Co-Gründer Manuel Zapp, der 2014/15 am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken zu einer sehr spannenden Zeit tätig war, wie er bekennt. „Die CEOs der DAX-Konzerne wollten damals wissen, wie wir KI für ihre Unternehmen verfügbar machen können. Die einen wollten Insights aus ihren Bestandsdaten, die anderen wollten automatisieren. Und dabei waren in 90 Prozent aller Fälle Dokumente involviert.“ Diese Dokumentenprobleme zu lösen, war die Gründungsidee von Natif.ai. Zapp nennt ein Beispiel, wie dabei der Einsatz von KI hilft: „Einer unserer Kunden ist eine Anwaltskanzlei, die einen Berg von Versicherungsdaten hat, wie Schadensgutachten, Restwert eines Autos nach einem Schadensfall oder den Wiederbeschaffungswert. Wir machen die Daten aus diesen Dokumenten für die Automatisierung verfügbar.“ Dabei hilft Natif.ai eine Technologie, die sich Deep OCR nennt. „Dokumente kommen bei uns auch mal als PDF an“, sagt Zapp. „Wenn man den Text aus den Dokumenten verfügbar machen will, funktioniert das unter Zuhilfenahme klassischer Technologien nur mäßig. Mit Deep Learning kann man solche Dokumente nicht nur viel präziser und korrekter auslesen, sondern schafft auch einen Datengrundstamm für das Training weiterer Modelle.“
Software bringt Licht in die „Black Box“ KI
KI vertrauenswürdig zu machen, ist das Ziel des Saarbrücker Startups QuantPi, das 2020 von KI und Business-Fachleuten des CISPA und der Universität des Saarlandes gegründet wurde. Vertrauen in KI entsteht nur, wenn deren Entscheidungen für den Menschen nachvollziehbar bleiben. Häufig ist KI aber heute noch eine „Black Box“, weil kaum jemand weiß, was die KI gelernt hat und wie sie zu ihren Vorhersagen gelangt ist. Die von QuantPi entwickelte Software setzt genau da an und will Entscheidungsprozesse von KI-Systemen nachvollziehbar und transparent machen. Die Software analysiert und überwacht KI-Modelle von Unternehmen und Institutionen und stellt klar, welche Daten und Kriterien in eine von einer KI getroffene Entscheidung geflossen sind. Die Responsible-AI-Plattform von QuantPi soll zum sicheren und selbstbestimmten Zusammenleben von Menschen mit intelligenten Maschinen beitragen und Gefahren abwehren. In der langen Phase der Forschung und Entwicklung bis hin zur Marktreife stand dem Team der CISPA Incubator zur Seite, sowohl inhaltlich als auch bei der Beschaffung von Mitteln aus dem Programm StartUp Secure des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BmBF). So ist QuantPi bereit für ein Thema, das in naher Zukunft wohl genau solche Wellen schlagen wird wie KI: die Quantencomputer.
Das könnte Sie auch interessieren:
Interview: „Cybersicherheit braucht Kooperation“
Fortschrittliche Medizin
Lokale Unternehmen und Organisationen:
Hoch hinaus – Weltraumforschung aus dem Saarland
Viele alltägliche Anwendungen auf der Erde werden durch die Weltraumforschung vorangetrieben. Forschende aus dem Saarland untersuchen, wie die Schwerelosigkeit Materialien und auch Menschen verändert.
Als am 21. Oktober des Jahres 2022 um 9:25 Uhr die Forschungsrakete MAPHEUS-12 des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt von der schwedischen Raketenbasis ESRANGE nahe Kiruna ins Weltall startete, hatte sie Materialien aus Saarbrücken an Bord: Das Leibniz-Institut für Neue Materialien (INM) hatte unter Leitung von Tobias Kraus, Forschungsgruppenleiter am INM und Professor für Kolloid- und Grenzflächenchemie an der Universität des Saarlandes, einen Versuchsaufbau mit Gold-Nanopartikeln zusammengestellt. Die Forschenden wollten beobachten, wie sich Partikel zusammenballen, wenn keine Schwerkraft auf sie wirkt.
Seit mehr als fünf Jahren arbeitet das INM-Team bereits an dem Forschungsprojekt. Schon bei Experimenten im 110 Meter hohen Fallturm in Bremen hatten die saarländischen Forschenden festgestellt, dass sich Feststoffpartikel während der neun Sekunden, in denen im freien Fall keine Gravitation auf sie einwirkt, wesentlich schneller zu Klumpen verbinden als auf dem Erdboden.
Experimente in der Schwerelosigkeit – Bessere Modelle und neue Materialien
Im Rahmen des Weltraumflugs in der Forschungsrakete, die eine Höhe von 260 Kilometern erreichte und dann an einem Fallschirm sanft zurück zur Erde schwebte, hatten die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler nunmehr sechs Minuten Zeit, um das Verhalten der Partikel in Schwerelosigkeit zu beobachten.
„Dass wir das Agglomerationsverhalten der Partikel über einen so langen Zeitraum beobachten konnten, bringt uns ein gutes Stück weiter. Je mehr Daten uns zur Verfügung stehen, desto besser können wir unsere Vermutungen prüfen“, sagt Kraus. „Noch sind nicht alle Daten ausgewertet. Wir hoffen, bessere Modelle für die Agglomeration zu schaffen und sie für neue Materialien nutzen zu können, beispielsweise für die Elektronik.“
Prof. Dr. Tobias Kraus, Forschungsgruppenleiter am INM und Professor für Kolloid- und Grenzflächenchemie an der Universität des Saarlandes
Experimente in der Schwerelosigkeit durchzuführen ist ein sehr spannender Ansatz in der Materialforschung. Sie lenken den Blick auf Prozesse und Eigenschaften von Materialien, die man auf der Erde leicht übersieht. So trägt die Weltraumforschung dazu bei, auch alltägliche, „irdische“ Probleme zu lösen.
Experimente im All liefern der Medizin wichtige Hinweise
Aber es sind nicht nur Materialien, die sich in Schwerelosigkeit verändern – sondern auch Menschen. Damit beschäftigt sich die Weltraummedizinerin Bergita Ganse, die Professorin für Innovative Implantatentwicklung am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg ist. „In fast allen Körpersystemen gibt es Veränderungen. Es gibt einen Muskelabbau, das Herz schrumpft, das Gehirn wird an manchen Stellen kleiner und man wächst.“ Um durchschnittlich 5,5 Zentimeter werden Menschen in den ersten 24 Stunden im All größer – das liegt daran, dass sich die Bandscheiben ausdehnen. Auf der Erde angekommen, schrumpfe der Körper auf die ursprüngliche Größe zurück, so Ganse. Auch das Gehirn passt sich dem Leben im All an: Nach einem Raumflug lassen sich makrostrukturelle Veränderungen des Gehirns feststellen, etwa mit Blick auf das Gewebevolumen und die Verteilung und Dynamik der Liquorflüssigkeit. Diese Veränderungen könnten damit zusammenhängen, dass Reize und soziale Interaktionen abnehmen.
„Der Körper reduziert immer alles, was nicht gebraucht wird. Deshalb stellt sich auch die Frage, ob etwas Ähnliches passiert, wenn wir etwa wegen Corona zu Hause in Isolation sind.“
Prof. Dr. Bergita Ganse, Weltraummedizinerin und Professorin für Innovative Implantatentwicklung am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS)
Die Experimente im All könnten Hinweise dafür liefern. Als Folge von Schwerelosigkeit verschieben sich zudem die Flüssigkeiten im Körper: Die Astronautinnen und Astronauten bekommen ein dickes Gesicht und dünne Beine, weil das Blut nicht mehr von der Schwerkraft nach unten gezogen wird, sondern in Richtung Oberkörper und Kopf wandert. Bei längeren Aufenthalten im Weltall kommt es zum Muskelabbau im ganzen Körper, denn die Muskulatur wird in der Schwerelosigkeit kaum beansprucht. Wenn die Astronautinnen und Astronauten zur Erde zurückkehrten, seien ihre Beine am Anfang so weich wie Gummi, erklärt Ganse. „Man muss einige Tage einplanen, bis man wieder normal gehen kann. Bis sich die Knochensubstanz wieder erholt hat, kann es mehrere Jahre dauern.“ Die Erholung von Knochensubstanz ist auch abseits der Weltraumforschung ein Schwerpunktgebiet der Chirurgin. Sie entwickelt nämlich mit ihrem Team intelligente Implantate, die nach Knochenbrüchen zum einen Informationen zum Heilungsverlauf an die behandelnden Ärzte funken – und zum anderen durch mechanische Reize den Wiederaufbau der Knochensubstanz und damit die Heilung vorantreiben. Auf diese Weise sollen die Behandlungsdauer und damit der Leidensweg der Betroffenen verkürzt werden. Das habe auf den ersten Blick nichts mit Weltraum und Schwerelosigkeit zu tun, auf den zweiten aber schon, so Ganse. „Es handelt sich nämlich um exakt dieselben Mechanismen.“
„Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut“ – 3 Fragen an Astronaut Dr. Matthias Maurer.
Astronaut Dr. Matthias Maurer
Zum InterviewDas könnte Sie auch interessieren:
Magazinbeitrag: Hoch hinaus
Fortschrittliche Medizin
Lokale Unternehmen und Organisationen:
Fortschrittliche Medizin